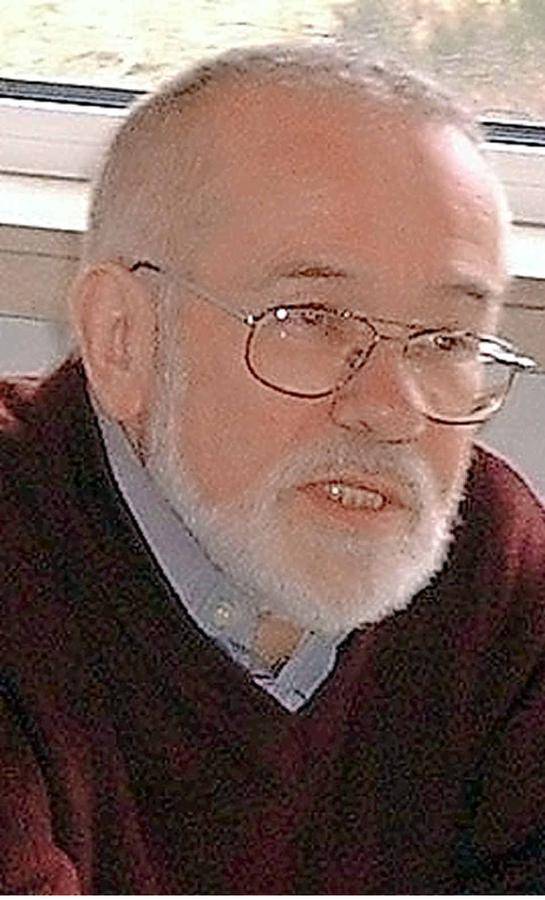Auf der Glatze Locken drehen
Die erste Bekanntschaft mit Karl Kraus machte er Anfang der 80er Jahre in Berlin. Jonathan Franzen hatte gerade sein Germanistikstudium in Amerika abgeschlossen und erhielt in Deutschland ein Stipendium.
Die Freundin hatte ihn betrogen; der Versuch, aus Rache mit einer anderen ins Bett zu steigen, war gerade gescheitert. Die Welt drohte unterzugehen. Bis der wütende junge Franzen im Vorlesungsverzeichnis ein Seminar über "Die letzten Tage der Menschheit" entdeckte - während um ihn herum bald ein Student nach dem anderen den Kurs aufgab, setzte der Amerikaner es sich in den Kopf, die einzige Person im Seminar zu sein, die Kraus tatsächlich las und auch verstand.
Während der Vorbereitung seines Referats rauchte Franzen so viel, dass er sich mit einem "Dickens'schen Husten" quälen musste. Es lohnte sich. Erlebte er doch einen der "stolzesten Momente seines Lebens" als der Professor ihn lobte: "Das ist eine Lektion für uns alle: Da musste erst ein Amerikaner kommen, um uns zu erklären, was wir ein ganzes Semester lang zu verstehen versucht haben."
Zurück in den USA machte sich Franzen an die Übersetzung der beiden Aufsätze "Heine und die Folgen" und "Nestroy und die Nachwelt", die er im Berliner Kraus-Seminar mitbekommen hatte. Sein Professor daheim lobte die Anstrengungen, schrieb aber auch, wie "teuflisch schwierig" es sei, Karl Kraus zu übersetzen. Den Wink verstand Jonathan Franzen und heftete die Übersetzungen in einem Aktenordner ab, den er ins Regal stellte - ganz weit hinten.
Erst als er Jahre später in Wien Daniel Kehlmann kennenlernte, mit dem er ausgiebig über Karl Kraus diskutierte, nahm er sich die Ordner wieder vor. "Das Kraus-Projekt" nahm seinen Lauf. Zu den Übersetzungen schrieb Franzen eigene Fußnoten. Der Literaturwissenschaftler Paul Reitter gesellte sich dazu und kommentierte die Aufsätze ebenfalls. Selbst Kehlmann schaltete sich mit einigen Anmerkungen ein.
Entstanden ist so ein Diskurs über den Publizisten Karl Kraus . Nicht unbedingt etwas für die Leser von Franzens Romanen ("Die Korrekturen", "Freiheit"). Eher etwas für Literaturstudenten. Und zwar für die höheren Semester . Um es ehrlich zu sagen: Die Aufsätze von Karl Kraus sind heute nahezu unlesbar. Bewusst führte er Anfang des 20. Jahrhunderts einen Kampf um die Unverständlichkeit seiner Texte, um sich von der Masse abzugrenzen.
In Heinrich Heine sah er den Übeltäter, der die Form über den Inhalt gestellt und so unter Journalisten viele Nachahmer gefunden habe. "Ein Feuilleton schreiben heißt, auf einer Glatze Locken drehen; aber diese Locken gefallen dem Publikum besser als eine Löwenmähne der Gedanken." Der nach Paris ausgewanderte Heine sei zwar ein Talent gewesen, habe aber keinen Charakter besessen, so Kraus. "Ohne Heine kein Feuilleton . Das ist die Franzosenkrankheit, die er uns eingeschleppt hat." In der Zeitschrift "Die Fackel" kämpfte der Österreicher vehement gegen diesen "Wegwerfjournalismus". Franzen vergleicht Kraus mit einem Blogger. Die Stimmung in Wien vor dem Ersten Weltkrieg sei gewesen wie die heute in den USA: "ein ebenfalls geschwächtes Imperium, das sich seine Einzigartigkeit einzureden versucht, während es auf eine Apokalypse zusteuert."
Doch so sehr sich Franzen auch müht, die Worte von Kraus in die Gegenwart zu transformieren: Er bringt sie einem nicht näher. Die Texte des Wieners sperren sich zu sehr. Lesbar sind nur die Fußnoten, in denen Franzen aus dem Nähkästlein plaudert und von sich selbst erzählt, wie er es in manchen Essays ("Weiter Weg") und in seinen autobiografischen Erzählungen ("Die Unruhezone: Eine Geschichte von mir") getan hat. Früh hat er erkannt, dass er mit Romanen die Menschen besser erreichen kann als mit theoretischen Schriften. Dafür wäre als neuer Beweis nicht dieser literaturtheoretische Diskurs nötig gewesen.
Jonathan Franzen : Das Kraus-Projekt. Rowohlt, 304 Seiten, 19,95 Euro.