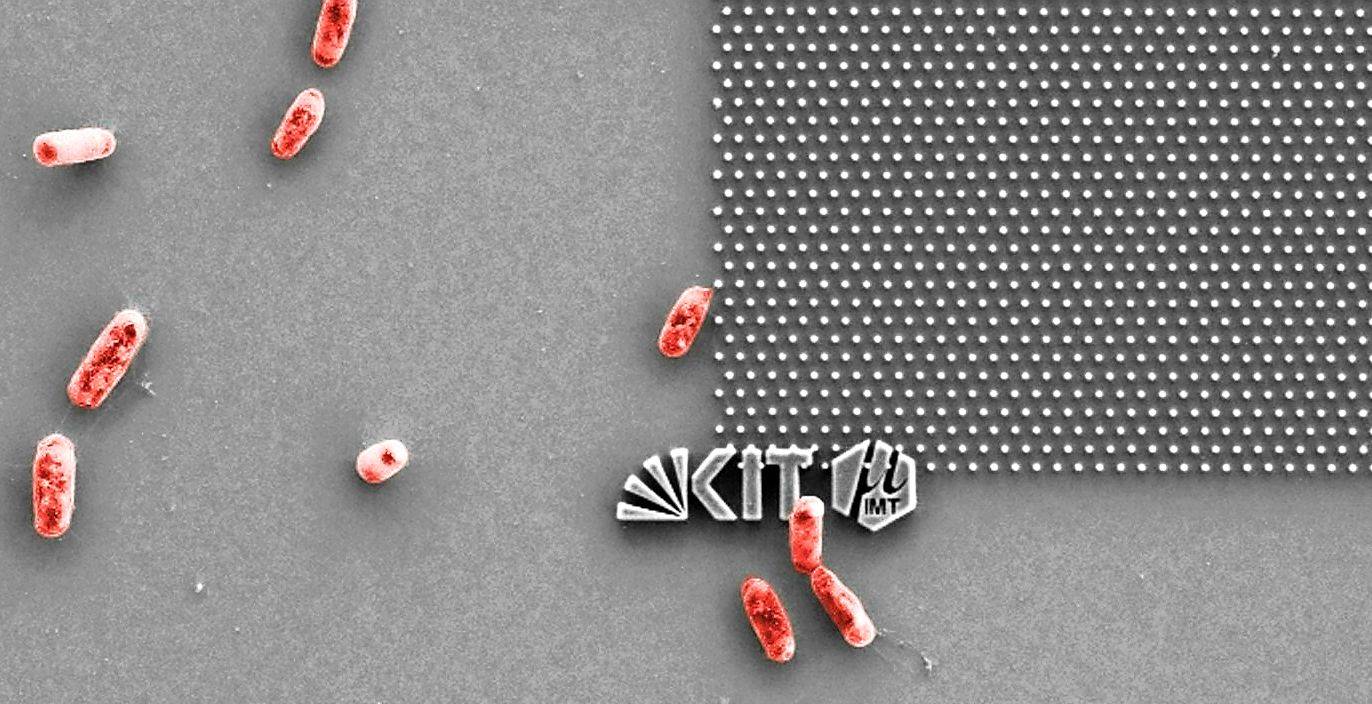OP-Simulator Fingerübungen für Chirurgen
An der Saarbrücker Pelvic School können angehende Ärzte endoskopische Eingriffe in einem OP-Simulator üben.
Was haben Ärzte und Piloten gemeinsam? Beide gehören zu den Berufen mit dem höchsten Sozialprestige in Deutschland. Zum „Herrn Flugkapitän“ schauen wir bewundernd nach oben, wenn sein Jet über den Himmel zieht, zum „Herrn Doktor“ blicken wir hoffnungsvoll auf, weil wir von ihm Rat und Hilfe erhoffen. Doch diese Berufe eint mehr als nur die Tatsache, dass sie schwierig zu erlernen sind und zu hoher Arbeitsbelastung bei überdurchschnittlichem Einkommen führen können. Sowohl dem Mediziner als auch dem Flugzeugführer sind Menschenleben anvertraut. An jedem Arbeitstag.
Piloten üben deshalb regelmäßig in Flugsimulatoren für den Fall der Fälle, obwohl die meisten den zum Glück nie erleben. Und die Mediziner? Bei ihnen ist der Notfall oft der Normalfall, zumindest im OP. „Das Management von Notfallsituationen muss daher differenziert geübt werden“, fordert der Herzchirurg Dr. Andreas Beckmann. Er ist Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz und Gefäßchirurgie und verlangt für Mediziner, was für Piloten seit den 1930er Jahren selbstverständlich ist: „Simulationstrainings, sowohl im Studium als auch im Rahmen der ärztlichen Weiterbildung.“ Denn kritische Situationen „dürfen nicht am Menschen, sprich Patienten, geübt werden“.
„Doch die Umstellung des traditionellen operativen Ausbildungssystems am Patienten auf ein Simulationssystem ist leichter gefordert als verwirklicht“, sagt die Saarbrücker Ärztin und Privatdozentin Dr. Carolin Spüntrup. Der stetig wachsende wirtschaftliche Druck in den Krankenhäusern habe dazu geführt, „dass OP-Zeiten teuer geworden sind und keine Ressourcen mehr für die zeitaufwendige Ausbildung junger Mediziner zur Verfügung steht“. Dabei rechne sich das Training am Simulator gleich mehrfach. Für Patienten, Kliniken und den Nachwuchs-Operateur, der mehr Sicherheit gewinne, so Spüntrup.
Die Gynäkologin trainiert Nachwuchsmediziner an Simulatoren in der sogenannten Schlüsselloch-Chirurgie. Bei zwei Dritteln aller Operationen im Unterleib ist sie mittlerweile Standard. Kliniken sparen durch die Technik wegen der kürzeren Liegezeiten, Patienten kommen früher und mit weniger Schmerzen aus dem Krankenhaus – doch für Mediziner ist die schonende OP-Technik schwieriger zu erlernen. Ein Einser-Abitur und glänzende Noten in der medizinischen Theorie nutzen nichts, wenn‘s darum geht, mit einem 30 Zentimeter langen Greifer durch ein Metallrohr mit einer zehn Millimeter langen Nadel unter Kamerakontrolle Wundränder im Körper zu vernähen. Wer ein Gefühl bekommen möchte, wie schwierig das ist, kann einmal versuchen, unter optischer Kontrolle einer Smartphone-Kamera mit einer Pinzette einen Faden in eine Nähnadel einzufädeln.
Carolin Spüntrup studierte in Köln und arbeitete als leitende Oberärztin an einer Klinik in Dormagen. 2012 gründete sie in Saarbrücken ein internationales Ausbildungszentrum für endoskopisches Operieren (Pelvic School), das auch mit der Medizinischen Fakultät der Saar-Uni kooperiert. Im vergangenen Jahr wurde sie für die Entwicklung eines endoskopischen OP-Simulators mit dem Kurt-Semm-Preis der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Endoskopie ausgezeichnet (wir haben berichtet).
Zwischen 80 und 100 Medizinstudenten der Saar-Universität üben in jedem Jahr im Rahmen ihres Studiums an speziellen OP-Simulatoren. Von ihnen gibt es zwei Varianten. Die erste ist eine simple Box von der Größe eines Brotkastens, spartanisch ausgestattet, aber dafür transportabel. Unter Kamerakontrolle kann der Medizinernachwuchs in dieser OP-Box auf einer weichen Kunststoffmasse Näharbeiten im menschlichen Körper üben. Die zweite Variante simuliert den Operationssaal im Verhältnis eins zu eins – ausgenommen die sterile Atmosphäre. Auf dem OP-Tisch liegt ein Dummy aus Plastik, dessen Innenleben, so erklärt die Leiterin der Pelvic School, aus einem patentierten Material besteht, dessen Form und Struktur den Organen gleicht, welche die Mediziner später tatsächlich operieren. Die Instrumente sind echt. Was er tut, sieht der angehende Chirurg auf einem Monitor in zwölffacher Vergrößerung wie später im Operationssaal.
Doch auf die Vergrößerung allein kommt es nicht an, erklärt Carolin Spüntrup. Das Kamerabild ist zweidimensional, der Eindruck räumlicher Tiefe geht verloren. Hier fällt die Orientierung im ersten Moment extrem schwer. Diese Nachteile muss der Operateur durch Können, anatomisches Wissen, handwerkliches Geschick und Erfahrung ausgleichen. „Es geht nicht nur darum, präzise zu arbeiten, viel wichtiger noch ist es, immer den Überblick zu bewahren.“ Das entscheide am Ende über Erfolg oder Misserfolg eines Eingriffs.
„Früher bin ich oft tausend Tode gestorben, wenn ich einen jungen Arzt das erste Mal operieren sah“, erinnert sich die leitende Oberärztin. Im OP-Simulator hat ein Fehler dagegen keine Konsequenzen. Oder doch zumindest fast keine. Geht bei einem Schnitt im Simulator etwas schief, trübt eine rötliche Flüssigkeit den Blick der Kamera ins Operationsgebiet. „Im Ernstfall wäre das jetzt allerdings eine Blutung gewesen.“ Wie präzise ein Chirurg vorgehen muss, erklärt Carolin Spüntrup an folgendem Beispiel: „Junge Frauen haben gelegentlich Zysten an einem Eierstock. Wenn die eine Größe von einigen Zentimetern überschreiten, müssen sie meist operiert werden.“ Bei diesem Eingriff greift der Arzt den Eierstock mit einem Instrument an seiner Aufhängung im Becken, einem etwa zwei Zentimeter breiten Band. Durch dieses Band verläuft aber auch ein Teil seiner Blutversorgung. „Wer hier nicht aufpasst und zu fest zupackt, zerreißt das Band und durchtrennt damit die Blutversorgung. Deshalb ist der OP-Simulator zum Üben so wichtig.“
Den Erfolg einer Schulung im Simulator misst die Leiterin der Pelvic School in einer recht ungewöhnlichen Maßeinheit: in Knoten. Am Ende jeder Operation müssen die Wundränder im Unterleib wieder vernäht werden. Und das dauert. Ein Anfänger am Endoskop benötigt für seinen ersten chirurgischen Knoten statistisch 23 Minuten. „Unsere Schüler schaffen im Durchschnitt nach zwölf Durchgängen einen Knoten in sechs Minuten.“